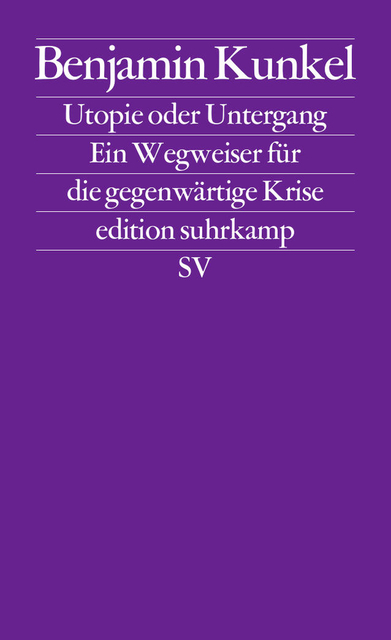 Wie der Romanautor Benjamin Kunkel zum Wirtschaftsexperten und führenden „marxistischen“ Intellektuellen der USA seiner Generation wurde.
Wie der Romanautor Benjamin Kunkel zum Wirtschaftsexperten und führenden „marxistischen“ Intellektuellen der USA seiner Generation wurde.
Der Falter, 15. April 2015
Es ist ja nicht so, dass die jungen Leute in den USA heute alle an den Sozialismus glauben würden. Denn „glauben“ ist dafür ohnehin nicht ganz das richtige Wort. Aber wenn sie sich zwischen dem Glauben an den Sozialismus und dem Glauben an den Kapitalismus entscheiden müssten, dann ist nicht so sicher, ob der Kapitalismus noch gewinnen würde. Also, zumindest unter Hipsters in Manhattan. Oder zumindest unter denen in Brooklyn. Und dafür gibt es genug Gründe: vom Terror der Geldwelt über die Gentrifizierung, die himmelschreiende Ungleichheit und der Herrschaft des „einen Prozent“, also der Superreichen. Krisengefühl! Es muss etwas Neues her! Eine der Zentralfiguren der neuen amerikanischen Linken ist Benjamin Kunkel. „Zur Enttäuschung jener Freunde, die lieber meinen nächsten Roman gelesen hätten – und meiner Agentin, die ihn lieber verkauft hätte -, bin ich offenbar eine marxistischer Intellektueller geworden“, heißt es schon im Eingangssatz seines jüngsten Buches „Utopie oder Untergang“.
Schlabber-T-Shirt, struppige Haare, dunklebraune Augenringe, so steht er im Arts-Laboratorium in New Jersey und spricht über den „Commonismus“, der ihm vorschwebt – im Unterschied zum „Kommunismus“. Kunkel denkt mehr vor sich hin als dass er predigt. Agitator im Jean-Ziegler-Stil ist er ebenso wenig wie flamboyanter Radical-Chic-Showman von der Slavoj-Zizek-Art. Für all das scheint er nicht gemacht und vor allem stets viel zu müde zu sein. Kunkel, die neue Art „öffentlicher Intellektueller“ hat man ihn und seinen Freundeskreis schon vor zehn Jahren genannt. Da haben sie noch sarkastisch zurückgefragt: „Schön, aber wie groß ist diese Öffentlichkeit?“
 Kunkel vor allem ist es zu verdanken, dass in den USA schon vom „Comeback von Marx“ (Salon.com) gesprochen wird, das New York Magazine widmete seiner Verwandlung vom „Romancier zum marxistischen öffentlichen Intellektuellen“ eine Riesenstory. Dabei, so eine riesengroße Verwandlung war das auch wieder nicht. Schon vor zehn Jahren, als Kunkel seinen vielgefeierten Roman „Unentschlossen“ veröffentlichte, galt er mit einem Schlag als authentische Stimme einer Generation, die irgendwie kritisch ist, aber nicht in die Gänge kommt, die durch’s Leben driftet. Kunkel hatte das im leichten, fast comedyhaften Sound erzählt an Hand seiner Hauptfigur Dwight Wilmerding, eine Art extraunglücklichen Holden-Caufield-Typus. „Du bist ein wandelndes Klischee“, sagt seine Freundin einmal: „Und noch nicht einmal ein neues“. Wilmerding wurde als symptomatischer Charakter gelesen, weil er einen Generation angehört, der das Haulden-Caufield-hafte von den Vorgängergenerationen nur als zerschlissener Lifestyle überlassen wurde, der im Second-Hand-Laden längst von der Stange zu haben ist. Was Dwight von anderen literarischen Figuren dieses Zuschnitts unterscheidet: Er sieht das als Problem. Als ihm einer seiner Wohngemeinschaftskumpels eröffnet, die chronische Unentschlossenheit habe einen Namen – Abulie –, und könne mit Tabletten behandelt werden, greift er sofort zu. Fest entschlossen, was er freilich zu verbergen versucht, aus Angst, „der entschlossen ausgedrückte Wunsch, von Unentschlossenheit geheilt zu werden, könnte einen Probanden womöglich von vornherein disqualifizieren“. Er besucht eine Schulfreundin in Ecuador, die ihn dann aber mit ihrer Freundin Brigid sitzen lässt. Mit der, einer Kämpferin gegen Unrecht jeder Art, macht Dwight einen Trip in den Dschungel, wo er eine Art Damaskuserlebnis hat: als zielloser Twentysomething fährt er in den Busch, als „demokratischer Sozialist“, als verknallter und beziehungsfähiger noch dazu, kommt er heraus. All das ist extrem komisch erzählt und Kunkel galt praktisch über Nacht als neue literarische Sensation New Yorks.
Kunkel vor allem ist es zu verdanken, dass in den USA schon vom „Comeback von Marx“ (Salon.com) gesprochen wird, das New York Magazine widmete seiner Verwandlung vom „Romancier zum marxistischen öffentlichen Intellektuellen“ eine Riesenstory. Dabei, so eine riesengroße Verwandlung war das auch wieder nicht. Schon vor zehn Jahren, als Kunkel seinen vielgefeierten Roman „Unentschlossen“ veröffentlichte, galt er mit einem Schlag als authentische Stimme einer Generation, die irgendwie kritisch ist, aber nicht in die Gänge kommt, die durch’s Leben driftet. Kunkel hatte das im leichten, fast comedyhaften Sound erzählt an Hand seiner Hauptfigur Dwight Wilmerding, eine Art extraunglücklichen Holden-Caufield-Typus. „Du bist ein wandelndes Klischee“, sagt seine Freundin einmal: „Und noch nicht einmal ein neues“. Wilmerding wurde als symptomatischer Charakter gelesen, weil er einen Generation angehört, der das Haulden-Caufield-hafte von den Vorgängergenerationen nur als zerschlissener Lifestyle überlassen wurde, der im Second-Hand-Laden längst von der Stange zu haben ist. Was Dwight von anderen literarischen Figuren dieses Zuschnitts unterscheidet: Er sieht das als Problem. Als ihm einer seiner Wohngemeinschaftskumpels eröffnet, die chronische Unentschlossenheit habe einen Namen – Abulie –, und könne mit Tabletten behandelt werden, greift er sofort zu. Fest entschlossen, was er freilich zu verbergen versucht, aus Angst, „der entschlossen ausgedrückte Wunsch, von Unentschlossenheit geheilt zu werden, könnte einen Probanden womöglich von vornherein disqualifizieren“. Er besucht eine Schulfreundin in Ecuador, die ihn dann aber mit ihrer Freundin Brigid sitzen lässt. Mit der, einer Kämpferin gegen Unrecht jeder Art, macht Dwight einen Trip in den Dschungel, wo er eine Art Damaskuserlebnis hat: als zielloser Twentysomething fährt er in den Busch, als „demokratischer Sozialist“, als verknallter und beziehungsfähiger noch dazu, kommt er heraus. All das ist extrem komisch erzählt und Kunkel galt praktisch über Nacht als neue literarische Sensation New Yorks.
Unpolitisch war dieser Roman natürlich bei weitem nicht. Geht ja gar nicht für einen wie Kunkel, der meint, „was immer Du schreibst, es handelt immer vom Spätkapitalismus, ohne dass man den Spätkapitalismus auch nur erwähnen muss. Der Kapitalismus hat ja alles infiltriert: wie wir kommunizieren, wie wir daten und welche Ängste wir haben.“
Auf einen zweiten Roman Kunkels wartet das Publikum freilich seit heute. Zunächst gründete er mit Kumpels seiner linken Künstler- und Schreiberblase das Magazin „n+1“, das als erstes explizit politisches Literatur- und Theoriemagazin einer neuen Generation erschien – andere radikale Zeitschriftenprojekte, wie das berühmte „Jacobin“, folgten. Dann schrieb Kunkel Theaterstücke.
Irgendwann dann ging er nach Argentinien, pendelte zwischen Bars und Wohnung hin und her und begann zu lesen, und zwar vor allem polit-ökonomische Fachliteratur. Lesen, lesen, lesen. Das Ergebnis dieser Lektüre ist eben der jüngst erschienene Essayband „Utopie oder Untergang“. Eine Sammlung von luziden Essays, die sich vordergründig an Autoren abarbeiten, für die und deren Themen sich Kunkel interessiert: David Harveys Krisentheorie, Frederic Jamesons Studien zu Totalkulturalisierung, Robert Brenners Arbeiten über globale ökonomische Turbulenzen, mit Graeber und Zizek und Groys und mit Thomas Pikettys ziegeldicker Studie über das Kapital im 21. Jahrhundert. Demnächst soll bei Verso-Books dann Kunkels Entwurf eines „Commonismus“ erscheinen, mitsamt seinen Erwägungen über den „stationären Staat“ (in dem es also kein Wachstum mehr gibt, weil wir ohnehin schon genug an Waren produzieren, dafür aber eine gleichmäßigere Verteilung) und seinen Thesen zur ökologischen Krise.
Jeder der einzelnen Essays wirkt vordergründig scheinbar philologisch, als ginge es nur darum, eben das Denken des jeweils Porträtierten zu umkreisen und freizulegen. Das alleine wäre eine lobenswerte Sache, vor allem wenn einem am laufenden Band solch tolle Skizzen gelingen wie die Folgende: „Jameson zu lesen hat mich schon immer ein wenig an das Gefühl erinnert, high zu sein. Die weniger spektakulären Essays waren, als wäre man beikifft: Während man sie las, erschienen sie einem unglaublich tiefgründig, doch am nächsten Tag konnte man sich an kaum etwas erinnern. … Dort jedoch, wo er zur Hochform aufläuft, ist Jameson so atemberaubend wie LSD oder Magic Moshrooms.“
Aber insgeheim sind die Essays durch eine Programmatik zusammen gehalten: Kunkel unterzieht die wichtigsten kulturtheoretischen Texte der Linken einer Relektüre. Man kann hinter sie nicht mehr zurückfallen, aber man muss sie auch abhaken, denn sie verdanken sich dem Umstand, dass einer geschlagenen Linken „als eigentliches Schlachtfeld nur die Kultur blieb“, die Theoretisierung von Identität, von Differenz, weil am Feld der Politik und der Wirtschaft ein Vierteljahrhundert der neoliberale Konsens herrschte. Jetzt steht nicht nur dieser Konsens auf der Kippe, sondern mehr noch das System. Nicht, dass Kunkel meinen würde, der klassische Marxismus reiche als Instrumentenkasten für all das aus, nein, der habe „nicht auf alles eine Antwort, er hat nicht einmal alle Fragen“. Weshalb Kunkel sich eher als „marxischer“ Intellektueller denn als „marxistischer“ versteht. Der Marxismus hat den Kapitalismus gelegentlich zu früh für todgeweiht erklärt und auch seine Fähigkeit, allgemeinen Wohlstand zu generieren, unterschätzt. Kunkel weiß das. Aber er weiß auch, dass der Kapitalismus eine stete Flucht nach vorn ist, kann ohne substantielles Wachstum nicht überleben kann, funktioniert er ja nach dem Prinzip „GOD“ – Grow or die. Marxistische Ökonomen wie David Harvey, besonders aber Robert Brenner stehen Pate, der schon vor der Finanzkrise in seiner „Economics of Global Turbulence“ eine wachsende Wackeligkeit des ökonomischen Systems konstatierte. Ganz auf dieser Linie ist auch Kunkels kluge Kritik an den Vorschlägen Thomas Pikettys zur Reduktion von Ungleichheiten: Kunkel stellt nicht nur in Frage, dass damit das System noch stabilisiert werden könnte, vor allem zweifelt er daran, dass diese Vorschläge eine Chance haben. Dass die Vermögenden und alle Regierungschefs der Welt gemeinsam eine spürbare Enteignung der Superreichen organisieren, um das System zu stabilisieren, sei, spottet Kunkel, noch unrealistischer als „eine sozialistische Revolution“.
Kunkel legt damit einen Finger auf die offene Flanke des zeitgenössischen Keynesianismus, wenngleich aus dessen Reihen heute durchaus ähnliche Analysen kommen. Paul Krugman, beispielsweise, äußerte unlängst die Befürchtung, „dass wir auf einen Crash des gesamten Systems zusteuern“. Und auch James K. Galbraith wagt in seinem neuen Buch einen eher düsteren Ausblick. Titel: „The End of Normal“ (siehe Interview mit Galbraith weiter unten auf dieser Website).
Man kann Kunkels scheinbar dunkelgraue Aussichten als eine Spielart von „Katastrophen-Marxismus“ missverstehen, soll heißen: anmerken, dass sie sich vielleicht auch nur in die lange Folge von Zusammenbruchstheorien einreihen werden, die dann doch nicht eingetreten sind. Doch er spielt eher Szenarien durch, Möglichkeiten. Zum Doktrinär taugt Kunkel ohnehin nicht, dazu ist er zu ironisch und zu selbstironisch. Sektiererischer Prinzipienreiter ist er schon gar keiner keiner. Er hat ja auch gar nichts gegen die sukzessive Reform des Systems. Wenn’s nützt, warum nicht? Wenn’s nichts nützt, gibt’s Plan B. Dass Gemäßigte und Radikale in verschiedene Richtungen ziehen würden, das hält er für eine fatale Fehlsicht. „Es ist doch hilfreich, wenn man ein paar Leute hat, die man als radikale Irre abtun kann, während man sich in ihre Richtung bewegt“, sagt er, und fügt hinzu: „Vor zwanzig Jahren wäre es auch verrückt erschienen, zu prognostizieren, dass ein Schwarzer zum US-Präsidenten gewählt wird und Schwule heiraten können.“ Reformer und Radikale nützen sich gegenseitig: „Die Hochzeiten des Wohlfahrtsstaates waren, letztendlich, von mehr Radikalisierung von Arbeitern und Studenten begleitet als die darauffolgende Ära des Neoliberalismus, der die Radikalen und die Reformisten gleichermaßen demoralisierte.“
Man muss kein Marxist und nicht einmal ein Radikaler sein, um zu sehen, dass es so wie zuletzt nicht weiter gehen kann. Aber es hilft.
Das Buch:
Benjamin Kunkel. Utopie oder Untergang. Ein Wegweiser für die gegenwärtige Krise. Aus dem Englischen von Richard Barth. 245 Seiten, Suhrkamp Verlag Berlin 2015. 18,50.- Euro