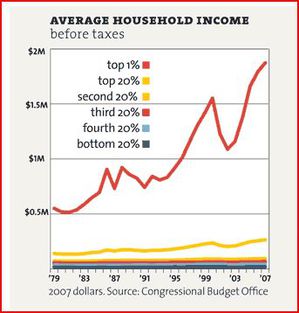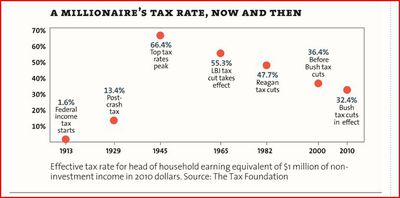Im vergangenen Oktober habe ich in diesem ausführlichen Beitrag argumentiert, dass mehr innerbetriebliche Demokratie und Mitbestimmung einer der Wege zu einem besseren Leben, aber auch zu einer produktiveren und stabileren Wirtschaft sei:
Ein höherer Grad an Mitbestimmung, die Möglichkeit, partizipativ an Entscheidungen von Unternehmen mitzuwirken, erhöht die Identifikation des Arbeitnehmers mit seiner Firma, was sich im Zeitverlauf ebenso in einem höheren Qualifikationsgrad und damit in höhere Produktivität übersetzt.
Die Empirie – etwa der Erfolg von Unternehmen mit einem hohen Grad an Mitbestimmung – widerlegt das in Wirtschaftskreisen beliebte Vorurteil, dass innerbetriebliche Demokratie „schnelle und effiziente“ unternehmerische Entscheidungen behindert und damit produktivitätssenkend wirke.
Jetzt gibt es dafür auch einen Nachweis in Form einer Modellstudie der Behavioral Economics. Der Informationsdienst Wissenschaft fasst die Untersuchung folgendermaßen zusammen:
Dass eine stärkere Einbeziehung der Mitarbeiter in betriebliche Entscheidungsprozesse die Motivation fördert, ist seit langem bekannt. Allerdings ist der damit verbundene Produktivitätseffekt in der realen Arbeitswelt nur schwer messbar. Wissenschaftler an der University of Massachusetts und dem Middlebury College im US-Bundesstaat Vermont entwickelten deshalb ein Verhaltensexperiment, in dem 180 Probanden durch das Lösen von Rechenaufgaben Geld verdienen konnten. Dabei wurden die Teilnehmer in Dreiergruppen aufgeteilt. Die Hälfte der Teams konnte per Mehrheitsbeschluss selbst darüber entscheiden, ob der gemeinsam erwirtschaftete Gewinn zu gleichen Teilen oder nach Leistung gestaffelt an die Mitarbeiter ausgezahlt werden sollte. Die andere Hälfte hatte auf das Vergütungsmodell keinen Einfluss.Das Experiment führte zu einem eindeutigen Resultat: Konnten die Teilnehmer mitbestimmen, waren sie leistungsbereiter und bearbeiteten im Schnitt sieben Prozent mehr Aufgaben. Zudem stieg die Produktivität, gemessen an der Zahl der richtig gelösten Aufgaben, um neun Prozent. Dabei spielte es keine Rolle, für welches Lohnmodell sich die Gruppe entschieden hatte. „Auch wenn sich die betriebliche Praxis unter Laborbedingungen nicht vollständig abbilden lässt, liefern diese Beobachtungen ein starkes ökonomisches Argument für mehr Demokratie am Arbeitsplatz“, sagt der Verhaltensökonom Jeffrey Carpenter, der die Studie mitverfasst hat. Auch für Deutschland seien aus einer stärkeren Verbreitung von Modellen zur Mitarbeitermitsprache nennenswerte Produktivitätszuwächse zu erwarten.
Mehr Mitbestimmung ist also eine Win-Win-Strategie: Sie führt zu mehr Lebenszufriedenheit, zu einer egalitäreren Gesellschaft (da in Mitbestimmungs-Unternehmen die Einkommensspreizung zwischen Niedrig-, Durchschnitts- und Spitzenverdienern meist niedriger ist), sie führt aber auch zu mehr Produktivität. Die Wettbewerbsfähigkeit leidet nicht, sie steigt sogar.
Die vollständige Studie finden Sie hier.