Hannuka, Weihnachten, Silvester, Geburtstag – und noch immer keinen Plan für ein Geschenk? Na dann, ich hätte da was 🙂 Mein Buch „Was Linke denken“. Ist ja nur so ein Vorschlag, keine Sorge, ich dräng niemandem was auf. Im Gegenteil: Hier unten gibt’s sogar gratis, quasi als kleine Test-Ration, ein paar Seiten aus dem Kapitel über die „Postmoderne“.
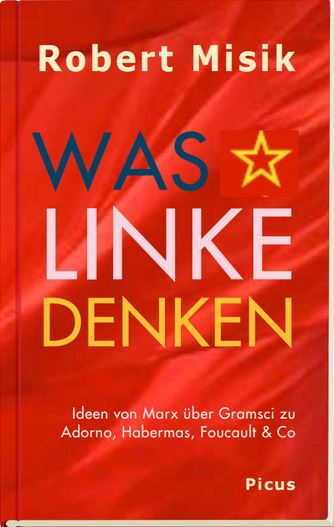
„Dieses Büchlein ist vollgepackt mit aufregenden Ideen … die beste Reklame für linkes Denken“ Zündfunk, Bayrischer Rundfunk
„Ein Meister des Feuilletons, wie es sie nur in Wien geben kann“ IN – das Münchner Stadtmagazin
„Verständlich und gut zu lesen“ Neues Deutschland
„Ein echtes Kunststück“ Frankfurter Rundschau
„Der Sound für die Generation Varoufakis“ Die Presse
Wenn die klassische Linke vor allem die großen ökonomischen Widersprüche des Kapitalismus analysierte und sich beispielsweise für das Proletariat allenfalls als revolutionäres Subjekt interessierte, darüber hinaus vielleicht noch ein paar Theorien aufstellte, wie aus dem konkreten Proletarier von heute mit seinen Macken und seelischen Schrammen ein „neuer Mensch“, das allumfassende entwickelte sozialistische Subjekt werden könnte, kurzum, wenn sich die klassische Linke für alles mögliche interessierte, nur für eines nicht, nämlich das konkrete Leben, dann rückte die Kulturtheorie genau dem buchstäblich auf den Leib. Etwa: Was tut dieser Proletarier im Alltag? Wie sehen die Eckkneipen aus, in denen er seinen Feierabend verbringt, in welche sozialen Strukturen ist er eingebettet? Geht er Sonntags auf den Fußballplatz? Was tun die Frauen im Proletariat so in der Freizeit? Seit wann haben er und sie überhaupt etwas, was sie mit dem Wort ‚Freizeit‘ bezeichnen? Welche Bedeutung haben Sportvereine für die proletarische Kultur? Wie verändert sich das in einem zunehmenden Konsum- und Kulturkapitalismus? Welche Sehnsüchte werden durch den Kauf von Waren gestillt, welches Zeichensystem etabliert die Mode, um uns in Besitz zu nehmen? All das wurde plötzlich interessant. Und es wurde nicht mehr mit dem Gestus des nörglerischen Fundamentalkritik abgehandelt, wie das noch die kritische Theorie tat („Vergnügtsein führt zu Einverstandensein“, „die Kulturindustrie verhindert Individualität“, „Freizeit ist nur unter verdinglichten Umständen zu denken, weil sie das Gegenteil verdinglichter Arbeit ist“), sondern in einem Stil des fröhlichen Interesses, das man auch als affirmativ bezeichnen konnte – aber man könnte auch sagen, dass diese Theorie neue gesellschaftliche Phänomene akkurater darstellen konnte, als es die bisherigen Theorien schafften. Nur ein paar Beispiele: Die alte Konsumkritik hätte in etwa in nörglerischen Ton gesagt, im Spätkapitalismus werden falsche Bedürfnisse geschafften, die Werbung schwatzt den Leuten Dinge auf, die sie gar nicht brauchen, die also für sie unnütz sind. Die neue Kulturtheorie fragte dagegen, wie das etwas Jean Baudrillard in seinem berühmten Buch „Das System der Dinge“ tat, welche „Sprache“ die Gegenstände sprechen? Womöglich wollen wir sie nicht wegen ihrer funktionellen Seite, sondern gerade wegen des Images, das die Gegenstände haben. Etwa den neuesten schicken Apple-Computer, der zwar auch nicht mehr kann als das Hewlett-Packard-Teil, aber einen symbolischen Überschuss hat; oder das Vintage-Möbel, das wir vielleicht mit „Authentizität“ und „langer Dauer“ assoziieren.
(…)
Ende der achtziger Jahre rückt freilich eine neue Autorengeneration ins Zentrum, die gänzlich alles umwirft; Autoren, die etwa die Systematik, der noch Lacan oder Foucault folgten, völlig hinter sich lassen. Ihre Bücher kommen als schnelle Flugschriften auf den Markt und erobern – etwa in Form der in Berlin produzierten Merve-Bändchen -, schnell das, was man neuerdings die „Szene“ nennt. Baudrillard mit seinem Büchlein „Koolkiller – oder der Aufstand der Zeichen“, in dem er Graffitis analysiert, oder mit seiner „Agonie des Realen“, oder auch Jean-Francois Lyotard mit einem Band namens „Intensitäten“. Worte werden als „Intensitäten“ behandelt, nicht als Träger von Bedeutungen, nicht mehr um Kritik geht es, sondern um „intensive Momente“. Auflösungen werden nicht beklagt, sondern gefeiert, das Lied eines Nihilismus gesungen, der auf Nietzsche zurückgreift. Der alte politische Aktivismus wird abehakt, dafür die minoritären Kämpfe, der Nomadismus, die Drogensüchtigen und Freaks gefeiert, die „intensiven Momente“. „Nicht-Repräsentativität, jederzeitige Absetzbarkeit, Punktualität, Intensität (…) Das sind die ‚Menschen der Steigerung‘, die ‚Herren‘ von heute: Außenseiter, experimentierende Maler, Popkünstler, Hippies und Yippies, Parasiten, Verrückte, Eingesperrte. Eine Stunde ihres Lebens enthält mehr an Intensität als tausend Worte eines Berufsphilosophen.“ Ein anderes legendäres Buch Lyotards trägt den Titel „Das Patchwork der Minderheiten“, in dem genau die Kämpfe dieser Minderheiten als die zeitgenössischen Aufstände beschrieben werden, ihre „Finten und Kniffe (…), einzeln, einzigartig und singulär (…) lässig und aktiv zugleich“, ein Patchwork, das „fortwährend die Herren austrickst“. Alle Ziele werden verlacht (die sind ja noch immer von der Fortschrittsidee mit ihrer Zeitachse Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft infiziert), und auch das „Vorurteil, es gäbe eine Wirklichkeit zu erkennen“.
Ein Denkstil breitet sich aus, der schon ebensoviel Kunst ist wie Theorie. Die nunmehr paradigmatischen Texte gehen von der Sachlichkeit der gewohnten akademischen Diskurse ab, mal trumpfen sie auf, dann flüstern sie wieder. Sätze werden auf eine Art zurechtgehauen, wie der Popstar seine Songs schreibt, mit Zeilen, deren Sinn ist, zu explodieren und die mindestens ebenso sehr mit Stimmung, mit Intimität als mit Bedeutung operieren. Theorieproduktion wird „der künstlerischen Tätigkeit vergleichbar“, wie der Pariser Theoretiker Alain Badiou schreibt, was einer französischen Tradition folgt, die Philosophie immer schon in Nachbarschaft der Literatur situierte (man denke an die Surrealisten, aber auch an Sartre zurück), diese aber radikalisiert und in gewissem Sinne damit auch bricht. Der Stil bisherigen philosophischen Schreibens soll genauso dekonstruiert werden wie seine bisherigen Inhalte. „Wir können uns kaum vorstellen, was für einen außerordentlichen Bruch mit dem zuvor herrschenden philosophischen Stil (dies) bewirkt hat… das Denken schlängelt sich bei dieser Arbeit wie ein Aal zwischen Wasserpflanzen hinduch. … All das zeugt von einem erbitterten Kampf gegen den etablierten Stil der Erörterung oder Abhandlung.“ (Badiou). Die Theorie rivalisiert mit der Literatur.
Mal wird ein hoher Ton elementarer Schärfe angeschlagen, dann wieder der ironische Sound, der dem Zeitalter langsam das Gepräge gibt. Wenn nichts wahr und nichts real ist und überdies alles gleich interessant, dann ist alles, was andere noch ernst nehmen, jederzeit dekonstrierbar, ja, dann ist man sogar in der komfortablen Position, auf alle anderen herabzublicken, denn die sind ja dann Naivlinge, die manche Dinge noch für echt oder ernst halten. Das ist die etwas unsympathische Seite dieser Theorie: Sie taugt auch ganz hervorragend als Handwerkszeug für Besserwisser.
(…)
Jedes Agieren ist ein Sprachspiel, das natürlich auch anders gespielt werden könnte. Der schon zitierte Terry Eagleton schreibt: „Das Werk Derridas und anderer hat die klassischen Begriffe von Wahrheit, Realität, Bedeutung und Erkenntnis auf heftigste in Zweifel gezogen, da sie alle auf einer naiven sprachlichen Repräsentationstheorie fußend entlarvt werden konnten. Wenn die Bedeutung, das Signifikat, ein flüchtiges Ergebnis der Wörter oder Signifikanen war, stets changierend und instabil, teils präsent, teils abwesend, wie konnte es dann überhaupt irgendeine festgelegte Bedeutung oder Wahrheit geben? Wenn die Realität durch unseren Diskurs weniger reflektiert als vielmehr hergestellt wurde, wie konnten wir dann jemals die Realität selbst erfahren und nicht bloß unseren eigenen Diskurs? War alles Reden einfach nur Reden über unser Reden? (…) Gab es überhaupt eine Vergangenheit, die man erkennen konnte und die nicht nur eine bloße Funktion des gegenwärtigen Diskurses war? (…) Ein Vorteil des Dogmas, dass wir Gefangene unseres eigenen Diskurses sind, nicht dazu fähig, bestimmte Wahrheitsansprüche vernünftig vor(an)zubringen, weil solche Ansprüche nur zu unserer Sprache in Beziehung stehen, besteht darin, dass es einem ermöglicht, in voller Montur durch die Überzeugungen aller anderen hindurchzugaloppieren, ohne dass es einem die Unbequemlichkeit aufbürdet, selbst eine Überzeugung anzunehmen.“ Und er fügt hinzu: Dekonstruktion, auf alles angewandt, ist auch eine Art Machtspiel, nur dass bei diesem nicht mehr der gewinnt, der seine Überzeugungen am Plausibelsten vorträgt, sondern „derjenige, der es geschafft hat, sämtliche Karten loszuwerden und mit leeren Händen dazusitzen“.
Spätestens an dieser Stelle hörte das postmoderne Denken selbstverständlich auf, im strengen Sinne eine Spielart linken Denkens zu sein. Schließlich ist es eine wunderbare Möglichkeit, einfach nichts zu tun, nichts ernst zu nehmen und alles um einen herum schon irgendwie okay zu finden, weil es ja schließlich nur gerade zufälliger Ausdruck eines Simulacrums ist, also einer sprachlich produzierten Phantasie-Realität. Man kann sogar noch weiter gehen, und sagen, am Ende schien die Postmoderne ihre Hauptaufgabe in der „Verbreitung höheren Blödsinns“ zu sehen, wie das ein Kritiker einmal formulierte und noch nachlegte: „Esoterik des Unfugs.“ Regelrechte Zornpfeile schoss Jürgen Habermas ab, der die Aufklärung, Vernunft und Moderne nicht abhakte, sondern im Gegenteil als „unvollendetes Projekt“ (an dessen Vollendung somit gearbeitet werden müsse) charakterisierte und den „Übertreibungen einer total gewordenen Vernunftkritik“ durch die Postmoderne mit großer Geste den Kampf ansagte.
Aber das ist allerhöchstens eine Seite der Medaille. Das postmoderne Wissen zerstört ja nicht nur Wissen und die Idee der Wirklichkeit, sondern etabliert ein Neues, das für das zeitgenössische Verständnis der Wirklichkeit prägend wird. Wissen entwickele sich nicht linear, sondern als „Wurzelwerk“, als „Rhizom“, schreiben Gilles Deleuze und Felix Guattari in ihrem bahnbrechenden Konvolut „Tausend Plateaus“. Es entwickle sich in horizontalen Netzwerken ohne Zentrum: „Ein Rhizom kann an jeder Stelle unterbrochen oder zerrissen werden, es setzt sich an seinen eigenen oder an anderen Linien weiter fort. Man kann mit Ameisen nicht fertigwerden, weil sie ein Tier-Rhizom bilden.“ Wie im Gehirn die Neuronen mit ihren synaptischen Verschaltungen sind auch moderne Gesellschaften und Wissenskulturen eher wie Wurzelbüschel zu denken, die Plateaus verbinden. Das Wissen baut nicht auf, sondern verknotet sich, fällt sich ins Wort. Die Sprache gibt uns gar nicht die Möglichkeit, das richtig darzustellen, weil sie aus Gründen der Darstellbarkeit, Konvention und Bequemlichkeit dazu verleitet – nein: regelrecht dazu zwingt -, eines nach dem anderen abzuhandeln, ebenso wie Bücher, die einer linearen Logik folgen, wo man Seite für Seite von einem zum nächsten kommt, man von vorne bis hinten weiterblättert. „Ideal für ein Buch wäre, alles … auf einer einzigen Seite, auf ein und der selben Fläche auszubreiten. (…) Ein Rhizom verbindet unaufhörlich semiotische Kettenglieder, Machtorganisationen, Ereignisse aus Kunst, Wissenschaft und gesellschaftlichen Kämpfen.“ Autoren wie Deleuze und Guatarri revolutionieren nicht nur das Wissen, sondern versuchen konsequent auch die Darstellungsweise von Wissen zu revolutionieren.
In einer bemerkenswerten Volte, an der freilich nichts Mysteriöses ist, wurden die selben Theorien, die in den achtziger Jahren den Soundtrack zur Entpolitisierung der ermüdeten 70er-Jahre-Linken lieferten, zwanzig Jahre später zu Ideenlieferanten für eine neue Politisierung junger Aktivisten, aber auch von Künstlern, Globalisierungskritikern und anderen. Widerständige minoritäre Praxen von Marginalisierten, Initiativen, Refugees, von Bewegungen, die flüchtig sind, aber sich stets neu gruppieren, die keine Masse oder keine Partei bilden, in denen die Einzelnen aufgehen, sondern als flexible Bündnisse von Singularitäten vorgestellt wurden, erschienen plötzlich als Königsweg zu einer Repolitisierung – das Echo, etwa von Lyotards „Patchwork der Minderheiten“ ist dabei ebenso unüberhörbar wie Deleuze und Guattaris Vernetzungslogik. Dass vom „System Politik“ mit seinen verknöcherten Organisationen wie Parteien, Gewerkschaften, Parlamenten und Ähnlichem keine Rettung zu erwarten, anstelle dessen die Hoffnung auf Basisbewegungen, Aktivismus, Nichtregierungsorganisationen zu legen ist, das ist für viele Linke heute Common Sense; ebenso, dass das Anderssein des Anderen, also die Differenz, zu achten ist und alle Versuche zur Vereinheitlichung vermieden werden müssen, dass die Marginalisierten für sich selbst sprechen sollen, dass auf diese Weise Passivität überwunden werden und zu Aktivierung beigetragen werden kann, all das gehört heute bei linken Tischgesprächen zum guten Ton. Und natürlich auch ein paar andere Standards des postmodernen Wissens: Dass Sprache Wirklichkeit konstitutiert („wer das Binnen-I nicht benützt, der stabilisiert den Sexismus“), dass schon die Wortwahl Hierarchisierungen und die herrschende Ordnung festigen kann, dass es so etwas wie Wahrheit nicht gäbe, dass alles Agieren auch immer ein Spiel mit Zeichen ist und das sogenannte Reale eine „symbolische Ordnung“, das ist tief in den linken Instinktfundus hinabgesunken, was sich beispielsweise sogar in der Sprache selbst wieder niederschlägt („Wir müssen ein Zeichen setzen, und sei es nur symbolisch“). Dass Demonstrationen selten auf faktische Weise eine Änderung dessen erzwingen, wogegen demonstriert wird, sie aber selbst Bilder und Zeichen produzieren, also auf der Ebene der symbolischen Ordnung der Zeichen agieren, ist jedem instinktiv klar, der an ihnen teilnimmt; ebenso, dass faktischer Erfolg dann wahrscheinlicher ist, wenn dem ein Erfolg auf der Ebene des Zeichenhaften voraus geht. Selbst die platteste Medienkritik kommt heute nicht ohne ein paar Versatzstücke über die „mediale Konstruktion von Wirklichkeit“ aus, und jeder Spin-Doctor im Dienste eines Ministers oder einer Premierministerin hat davon auch ein spontanes Wissen. Wie eingangs gesagt: Das postmoderne Wissen ist eines, das heute die meisten irgendwie haben, ein Wissen, das sich nicht mehr vergessen lässt. Für so ziemlich jedes zeitgenössische Individuum gilt: Wir sind alle postmoderner, als wir glauben würden.
Sehr geehrter Herr Misik,
ich bin kein „Linker“, werde wohl auch keiner mehr werden, außer in dem von Ihnen skizzierten Sinne, dass wir ja alle, also eigentlich irgendwie…
Beim Lesen des ersten Kapitels Ihres Buches fiel mir ein, dass ich vor Jahren (ausgerechnet) in einer wissenschaftstheoretischen Einführung eine Stelle aus dem Molière´schen „Bürger als Edelmann“ gelesen habe, die sehr treffend das „Philosophieren, ohne es zu wissen“ behandelt:
Herr Jourdain: … nun aber will ich Euch ein Geständnis machen. Ich bin verliebt in eine sehr, sehr vornehme Dame, und ich wünschte wohl, daß Ihr mir behilflich sein möchtet, ihr etwas in einem Billetchen zu schreiben, das ich zu ihren Füßen fallen lassen will. Wollt Ihr?
Der Philosoph: Sehr gern!
Herr Jourdain: Es muß recht galant sein, ja?
Der Philosoph: Jawohl. Wollt Ihr in Versen an sie schreiben?
Herr Jourdain: Nein, nein; nicht in Versen.
Der Philosoph: In Prosa also?
Herr Jourdain: Nein, weder Prosa noch Verse.
Der Philosoph: Eines von beiden muß es aber doch sein.
Herr Jourdain: Warum?
Der Philosoph: Weil man sich entweder in Prosa oder in Versen ausdrückt.
Herr Jourdain: Es gibt also nur Prosa oder Verse?
Der Philosoph: Ja, mein Herr. Was nicht Prosa ist, ist Vers, und was nicht Vers ist, ist Prosa.
Herr Jourdain: Und wie man spricht, was ist denn das?
Der Philosoph: Prosa.
Herr Jourdain: Was! Wenn ich sage: Nicole, bringe mir meine Pantoffeln, und gib mir meine Nachtmütze, so ist das Prosa?
Der Philosoph: Ja, mein Herr.
Herr Jourdain: Meiner Treu, ich habe also schon seit vierzig Jahren immer Prosa gesprochen, ohne es zu wissen? Ich bin Euch ganz außerordentlich verbunden, daß Ihr mir das beigebracht habt.
Nun, in diesem Sinne bin ich Euch, äh: Ihnen auch ausserordentlich dankbar, dass Sie mir beigebracht haben, eh auch ein Linker zu sein. Irgendwie.
Wofür ich noch danken möchte: Für die Idee zu diesem Buch, das wirklich hilfreich und aufschlussreich ist. In Studientagen habe ich mal die „Theorie der kapitalistischen Entwicklung“ von Paul M. Sweezy gelesen, doch das Buch endet kurz nach Rosa Luxemburg.
Für die erfrischende Art der Darstellung, die verständlich und knapp eine Idee oder einen Gedanken vermittelt, der unter Umständen nach dem Lesen der Originalliteratur nicht so klar gewesen wäre.
Für einen ironischen und distanzierten Stil, der mir vermittelt, dass „die Linke“ doch nicht ganz so homogen und solidarisch ist, wir mir das jene Freunde gerne vermitteln möchten, die ihren missionarischen Eifer bei mir noch immer nicht aufgegeben haben und mich zur wahren (=linken) Weltsicht bekehren möchten.
Ein tolles Buch, das ich
1. weiterempfehlen und
2. in manchen gebotenen Fällen verschenken
werde.
Beste Grüße
Herbert Synek