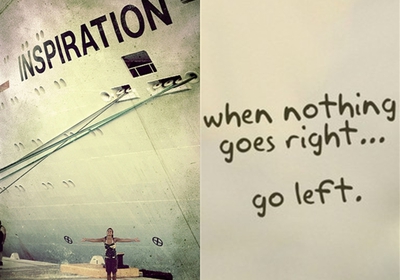Intensität als Lebensideal: Wille zum Extrem, Lebenshunger, Menschenappetit. Zur Geschichte und Gegenwart einer Sehnsucht.
Der Standard, Juli 2018
„Bekanntermaßen sind Frauen bereit, beim Liebhaber um des intensiven Gefühls willen, das er in ihnen erweckt, Eigenschaften – wie launisches Gebaren, Selbstsucht, Unzuverlässigkeit und Brutalität – zu tolerieren, die sie beim Ehemann niemals dulden würden“, schrieb die große Essayistin Susan Sontag einmal. Wir können Sontag überhaupt eine Ikone der Intensität nennen, eine, die das Intensive suchte, im eigenen Leben, im Tempo, mit dem sie dieses führte, aber auch in ihrer Literaturkritik. Beim Lesen und beim Denken erlebte sie „intellektuelle Ekstase“, das intellektuelle Begehren ähnle dem „sexuelle(n) Begehren“ notierte sie in ihre Tagebücher. Über Lyrik und Prosa schrieb sie, die Romantik verteidigte die Poesie, indem sie „prosaisch“ zu einem herabsetzenden Begriff machte, „in der Bedeutung von langweilig, abgedroschen, alltäglich, zahm“, während die Poesie „als ein Ideal von Intensität“ gefeiert würde.
Ohne Zweifel hatte die Autorin so etwas wie eine Sucht nach Intensität.
Dass echtes Leben im intensiven Erleben bestünde ist ein jahrhundertealtes Motiv, das sich als Ideal tief in unsere Gehirne festgesetzt hat. Schon in der Romantik hatte dieses Gedankenbild seinen ersten großen Höhepunkt im Kult um die „Kraft-Genies“, die keine Grenzen kannten, Konventionen umwarfen, die Tiefe des Erlebens feierten. „Abenteuerlust, Wille zum Extrem, Intensitätshunger, Liebe und Todeslust“, nannte das Rüdiger Safranski in seinem Buch über die Romantik. Der Begriff selbst wurde durch die moderne Physik popularisiert, folgt zunächst einer graduellen Metrik wie Schwelle oder Grad, von der Art: etwas wird nicht nur heißer, sondern die Hitze gewinnt an ganz neuer Intensität, Hitze ist mehr als nur wärmer als lauwarm.
Später, in der Lebensphilosophie, wurde bisweilen der Vitalismus hoch gehalten, gegen die kleinbürgerliche Einrichtung in einem langweiligen Leben.
Wer sich fügt in das „leere Verstreichen der Zeit“ der lebe in der „Uneigentlichkeit“, wie das Martin Heidegger verschwurbelt nannte. Dem setzte er die „Eigentlichkeit“ entgegen: „Eigentlichkeit ist Intensität.“ Selbst in Kriege zogen Menschen, um zum grellen Genuss einer intensiven Unendlichkeit zu kommen, und besangen das Erlebte dann noch, wie Ernst Jünger das etwa tat – als Ausbruch aus einer verwalteten Welt, in der es kein Risiko oder Abenteuer mehr gibt. Im Jugendstil und der Wiener Moderne wiederum waren „Nerven“ und „Nervosität“ ein großes Thema, weil der moderne Mensch nicht nur immer mehr Reizen ausgesetzt war, sondern weil die Suche nach dem intensiven Reiz selbst zu einem Ideal wurde. Leben hieß intensiv leben. Die „Hysterie“ war die Modekrankheit der Epoche, man brachte sie wie selbstverständlich mit überreizten Nerven in Verbindung.
„Das normale westliche Leben mit seiner niedrigen existenziellen Intensität wird von Rimbaud bis zum Surrealismus, von Thoreau bis zur Hippie-Bewegung … kritisiert“, notiert der französische Schriftsteller und Philosoph Tristan Garcia, der unlängst ein Buch geschrieben hat mit dem Titel: „Das intensive Leben – eine moderne Obsession.“
Der intensive Mensch würde geradezu zu einem „moralischen Ideal“, so Garcia. Das Laue steht im schlechten Licht, auch die Dauerhaftigkeit von Zuständen, die immer zu Routine und Verflachungen des Empfindens führen müssen. Nicht zuletzt unsere Bilder von der Liebe sind davon infiziert, sie sind meist Bilder vom grellen Blitz der Begegnung, von Beginnergefühl und selten Bilder, die etwa die Romantik der Dauerhaftigkeit hoch halten. Liebe ist etwas, schrieb der Philosoph Alain Badiou in seinem schmalen Büchlein „Lob der Liebe“, das für jeden das ausmacht, „was dem Leben Intensität und Bedeutung verleiht“. Sie ist ohne Risiko nicht zu haben. Liebe überwältigt, sie ist ein Absturz, „to fall in love“ heißt es nicht zufällig im Englischen. Einher ging mit all dem immer schon der Jugendkult, die Jugend war scheinbar definitionsgemäß mit Intensität, Entdeckergeist und Menschenappetit und Beginnergefühl verbunden, während das Alter sich rechtfertigen musste, denn letzteres „steht unter dem Verdacht, abgestorben und erstarrt zu ein“ (Safranski).
Forever Young, lebe schnell und verglühe früh. Bei Garcia liest sich das so: „…schnelles Leben, Entfesselung aller Empfindungen, das Verlangen, sich von den Intensitäten alles Kommenden durchzucken zu lassen, der Eindruck, dass der Lebenshöhepunkt in der Jugend, der Pubertät liegt, dass die Erfahrung als Erwachsener nur eine Folge von Anpassungen und Entsagungen, eine lange und langsame Verringerung der Lebensintensität ist.“
Wir haben Klischees im Kopf, und immerzu die gleichen Begriffe auf der Zuge. Dass man sich nur in der Intensität „wirklich spürt“ und all das. Intensives Leben wird als Gewitter beschrieben, als Vibrations und Vibes, unter Strom stehen (die Elektrizität war sehr bald eine Metapher des Intensiven), und womit immer es herbeigeführt werden kann, hat verführerische Kraft: „Drogen, Alkohol, Glückspiel, Verführungen, Liebe, Orgasmus, Freude.“ Kick und Adrenalinkick. „Begehren zur Spannungssteigerung“, wie das Jean-Francois Lyotard in seinen „Intensitäten“ nennt. Auch der politische Radikalismus und die Sehnsucht nach dem Umsturz oder der Revolution haben mehr als nur eine Prise dieser Intensitätsgier: Langeweile, eine Politik der kleinen Schritte und das öde Klein-Klein sollen in den Boden gestampft werden. Einbruch des Unvorhergesehenen, Neubeginn der Zeitrechnung, elementares Ereignis.
Nun ist der Kult des Ereignisses selbst zur Ideologie geworden, aber natürlich nicht reine Ideologie: Wo nichts geschieht, kann man nicht leben. Wer mag schon den Trott? Wenn das Leben nur mehr aus einem Weiter-so besteht, werden die Menschen unruhig. Jeder will Sicherheit, einerseits, aber genauso oft schlägt man alle Sicherheiten kaputt, wenn sich gar nichts mehr tut. Ganze Berufsgruppen leben davon, die Trümmer wegzuräumen, die die Midlife-Crisis überall anrichtet. Und wieder andere Branchen boomen, die versprechen, durch Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen erlerne man das „tiefe Empfinden“, von Yogo über Meditation bis skurrilen Therapien. Erlebnishunger und Sehnsucht nach Ekstase sind nicht die schlechtesten Eigenschaften der Menschen, schließlich sind sie mit Neugier verbunden, und das indifferente Fügen in einen leeren Lauf der Zeit ist keineswegs erstrebenswert. „man braucht die große tabula rasa, auf der man spielt, das beginnergefühl“, notierte Bertolt Brecht in sein „Arbeitsjournal“.
Aber der Kult der Intensität hat auch mehr als nur eine fragwürdige Seite. Menschen sind, beispielsweise, oftmals bereit, alles kurz und klein zu schlagen oder eine Apokalypse anzurichten, nur damit irgendetwas geschieht. Eine andere Fragwürdigkeit hat Tristan Garcia aufgespürt: das Ideal vom intensiven Leben hält eher eine Idee von Intensität hoch als eine Idee vom Leben. Der intensive Mensch intensiviert alle Vitalfunktionen, will also nichts anderes sein, als er schon ist – nur „mehr und besser“. Und endet schnurgerade in der Belanglosigkeit des Hedonismus, dem alles recht ist, was nur eine intensive Zeit verspricht. Das gleiche, aber nur in höherer Dosis, damit man es noch spürt. Welche Existenz man vorziehen mag, ist gleichgültig, Hauptsache man führt sie intensiv. Von Sex bis Krieg bis zum Kunsterlebnis – man kann alles intensiv machen. Die Idee der Intensität taugt daher auch bestens für die Kommerzialisierung und die Sprache der Werbung, jede Ware ist eine Intensitätsverheißung, die uns hilft, das, was wir ohnehin erleben, noch intensiver zu erleben, vom Partywochenende, intensiviert durch Koks, Ecstasy oder MDMA, bis zum gefühlsechten Kondom und zur Dating-App, die Liebeserlebnisse in höherer Zahl und in intensiverem Stakkato ermöglicht. Aber schon der letztere Fall zeigt den Kurzschluss solcher Intensitätsverheißung: Durch die Beschleunigung des Taktschlages werden die Dinge nicht notwendigerweise intensiver, sondern selbst zur Routine und zum verflachenden Erlebnis. Am Ende tut man dies und das, und gerade die Gier, es intensiv zu tun wird zur Routine.
Je mehr man über Intensität nachdenkt, desto mehr zerrinnt einem dieses eigentümliche Konzept zwischen den Fingern. Hat es mit einer graduellen Steigerung zu tun, oder gerade eben nicht? Ist Intensität mehr vom Vorhandenen oder eben die riskante Abkehr vom Vorhandenen? Ist Intensität bisweilen vielleicht sogar „weniger“? Nämlich – das Leben leer räumen, um überhaupt wieder etwas spüren zu können? Intensität kann darin bestehen, jede Erlebnismöglichkeit wahr – und damit nichts mehr ernst – zu nehmen, oder im genauen Gegenteil, etwas tödlich ernst zu nehmen.
Irgendwie ein Dilemma ohne Ausgang. Der Trott, der ist doch nicht das wahre Leben. Aber die permanente Intensivierung ist womöglich auch nur die falsche Lösung.