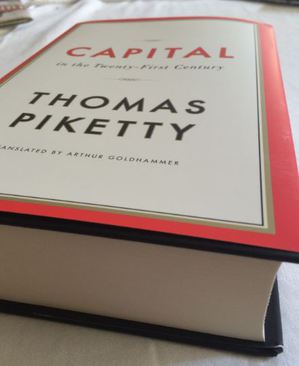 Können Bücher die Welt verändern? Oft kommt das nicht vor. Aber Thomas Pikettys „Capital in the Twenty-First Century“ könnte so ein Fall sein. Ein Beitrag für den Blog der IG-Metall.
Können Bücher die Welt verändern? Oft kommt das nicht vor. Aber Thomas Pikettys „Capital in the Twenty-First Century“ könnte so ein Fall sein. Ein Beitrag für den Blog der IG-Metall.
Es war längst klar geworden, dass die vorherrschenden Modelle und (Vor-)Urteile der Mainstreamökonomie mit der Realität nicht mehr zurande kommen, dass es einer völlig neuen Erklärung und neuer Politik bedarf. Eine junge Generation an Ökonomen und Wirtschaftspolitikern wartete sehnlich auf eine theoretische Ausformulierung, die die Wirtschaftswissenschaft auf eine neue Basis stellen sollte.
Als John Maynard Keynes dann 1936 seine „General Theory of Employment, Interest and Money“ vorlegte, war das genau das Buch, das alle erwartet hatten. Sperrig, wurde es ein Bestseller, über den sich alle beugten. Schon der Titel war ein großer Aufschlag, nicht eben ein Understatement: „Allgemeine Theorie der Beschäftigung, des Zinses und des Geldes“. Gerade, dass der Gelehrte sein Buch nicht „Eine wahre Theorie über so ziemlich alles“ genannt hat.
Es sind solche Momente, in denen Bücher die Welt verändern können: Wenn sich Erwartungshaltung, Problembewusstsein, Problemlagen und – in diesem Fall: ökonomische – Analyse verdichten, sodass ein Buch, wie man so salopp sagt, „zur rechten Zeit kommt“. Thomas Pikettys „Capital in the Twenty-First Century“ ist genau so ein Buch, und es könnte sein, dass es die Welt so verändert, wie es Keynes „General Theory“ getan hat. Der Autor ist Franzose, das Buch ist gerade eben erst auf englisch erschienen, eine deutsche Übersetzung beispielsweise liegt noch nicht einmal vor, aber es wird gefeiert und in jeder Zeitung besprochen. Der amerikanische Finanzminister studiert es ebenso wie der Papst, und die „Financial Times“ feiert es. „Man muss in die 1970er zu Milton Friedman zurückgehen, um einen Wirtschaftswissenschaftler zu finden, der einen solchen Einfluss ausübte“, schreibt der linke Essayist Will Hutton im „Guardian“. Neokonservative Autoren fordern verzweifelt, diese Studie müsse widerlegt werden, „denn ansonsten wird sie sich in der Ökonomenzunft verbreiten und die Landschaft der wirtschaftspolitischen Debatten neu sortieren und alle zukünftigen politischen Kämpfe bestimmen“. Paul Krugman, der linke, keynesianische Wirtschaftsnobelpreisträger nennt das Buch „eine Erleuchtung“ („superb“!) und spricht bereits von der „Piketty-Revolution“: „Dieses Buch wird die Art, wie wir über unsere Gesellschaft denken und die Wirtschaftswissenschaft verändern.“
Die Reichen werden reicher. Die Anderen werden es nicht.
Dabei mag auf dem ersten Blick gar nicht einmal so klar sein, was an diesem Buch so besonders neu ist. Piketty studiert die gesellschaftliche Ungleichheit in ihre Entwicklung in historischer Perspektive. Zunächst und vor allem ist das Buch empirisch: Piketty stützt sich auf eine grandiose Fülle an Datenmaterial, das Zensuserhebungen, Steuerdaten, die Entwicklung des Kapitalstocks ebenso wie die Löhne- und Gehälter in einer Fülle von Staaten in den vergangenen 200 Jahren umfasst. Er kommt zu einer Reihe von Ergebnissen, die so neu nicht sind: Die Reichen werden reicher, die Anderen werden es nicht. Rund ein Drittel des Reichtums in den entwickelten Industriestaaten wird vom obersten 1 Prozent kontrolliert, ein weiteres Drittel besitzen die Top-2- bis Top-10-Prozent, sodass die obersten 10 Prozent (die „Upper-Class“) rund zwei Drittel aller Vermögenswerte besitzen. Die untersten 50 Prozent besitzen praktisch nichts und das restliche Drittel teilt sich die „Mittelklasse“, also grob gesprochen das 11. bis 49. Prozent. Eine erhebliche Reichtumskonzentration – Tendenz steigend.
Nicht sehr viel besser sieht es bei den Einkommen aus: Das Top-1-Prozent realisiert einen wachsenden Teil der Einkommen, bei den Top-2- bis Top-10 gibt es auch noch teils erhebliche Zuwächse, der Rest hat allenfalls noch flache Realeinkommensgewinne, die allermeisten aber Stagnation oder sogar Realeinkommensverluste.
All das hat man grosso modo schon vorher gewusst, wenngleich Piketty aufgrund seines zentnerschweren Datenmaterials sehr viele Elemente hinzufügen kann, die das Bild detaillierter machen.
Was aber neu ist, ist die historische Perspektive: Piketty zeigt, dass das immer schon so, oder teilweise noch ärger war: Vermögen war immer konzentriert, und diese Konzentration tendierte immer zur Verstärkung der Konzentration. Im gesamten 19. Jahrhundert konzentrierten sich Reichtümer mehr und mehr, sodass am Ende die obersten 10 Prozent rund 90 Prozent des Kapitals kontrollierten. Für die restlichen 90 Prozent der Bevölkerung war praktisch nichts übrig geblieben.
Nur in zwei kurzen historischen Momenten, nach dem ersten und nach dem zweiten Weltkrieg, gelang es, diese Tendenz zu korrigieren, wofür vor allem vier Gründe ausschlaggebend waren: Erstens die Vernichtung von Kapital durch Krieg, Chaos, Enteignung und Inflation, zweitens progressive Besteuerung von hohen Vermögen und hohen Einkommen mit de facto zeitweise konfiskatorischen Steuersätzen, drittens überdurchschnittliche Wachstumsraten und viertens starke Gewerkschaften. Dies führte zu einer Mittelschicht in relativem Wohlstand, die selbst Vermögen aufbauen konnte: Jene nicht extrem breite, aber doch recht breite Schicht, die immerhin je nach Zeit und Ort 20 bis 30 Prozent aller Vermögenswerte besitzt.
Kapital konzentriert sich – ein Gesetz im Kapitalismus?
Jenseits dieser außergewöhnlichen historischen Phasen tendiert aber der Kapitalismus dazu, Vermögen zu konzentrieren, eine Oligarchie entstehen zu lassen, die ihr Einkommen nicht erarbeitet und schon gar nicht „verdient“, sondern als Kapitalrendite einstreicht und mehr und mehr ererbt. Pikettys historische Daten beweisen das empirisch, doch an dieser Stelle unterlegt der Wissenschaftler seine Empirie mit einer Theorie, mit Modellen und Formeln.
Pikettys wichtigste Formel lautet: r > g. Soll heißen: Die Rendite auf Kapital ist größer als das Wirtschaftswachstum. Die durchschnittliche Rendite auf alle Kapitalarten, vom kleinen Sparbuch über Landbesitz, Mieterlösen aus Immobilienbesitz über Staatsanleihen, von Aktienbesitz bis Unternehmensbesitz ist über die Jahrhunderte erstaunlich stabil und beträgt 4 bis 5 Prozent. Man beachte: Es handelt sich um einen Durchschnittswert, denn, wie wir wissen, Zinsen auf Spareinlagen liegen oft nur bei zwei Prozent oder sogar weniger, Unternehmensprofite oft durchaus bei 10 Prozent oder höher.
Daraus folgt: Umso niedriger das Wachstum, umso höher ist die Differenz zwischen r und g, desto mehr wächst der Anteil des Kapitals am Nationaleinkommen. Auf dem Weg zu diesen sehr simpel anmutenden Zusammenhängen zeigt uns Piketty eine Reihe erstaunlicher wirtschaftshistorischer Begebenheiten, die dem, was man den „Conventional Wisdom“ nennen könnte, widersprechen. So neigen wir dazu, Wirtschaftswachstum zu überschätzen. Tatsächlich beträgt die Wachstumsrate pro Kopf – also das „wirkliche Wachstum“ durch Produktivitätsgewinne und technologischen Fortschritt und Ausweitung der Produktion – selten mehr als ein Prozent pro Jahr in den vergangenen zweihundert Jahren, und meistg erheblich weniger – 0,5 oder 0,6 Prozent. „Wachstum war in der Realität immer relativ langsam“, schreibt Piketty. Nur in den Jahren nach 1950 war es signifikant höher. In der Vergangenheit verdanken sich – grob gesagt – die Hälfte der Wachstumsraten dem Bevölkerungswachstum. Was ja auch leicht verständlich ist: 11 Leute produzieren mehr als 10, da braucht es noch keinen technologischen Fortschritt dafür.
In den entwickelten kapitalistischen Gesellschaften ist es nun so, dass die hohen Produktivitätszuwächse der 1950ff Jahre nicht mehr erzielt werden können, und der demographische Faktor überhaupt nichts mehr zum Wachstum beiträgt. Kurzum: Wir sind in einem Slow-Growth-Regime.
Eine neue Oligarchie
In der theoretischen Seite des Pikettyschen Modells liest sich die ganze Chose so: Wenn die Kapitalrendite deutlich über der Wachstumsrate liegt, was sie in den meisten Phase der Wirtschaftgeschichte tat und in Zukunft schon aus demographischen Gründen verstärkt tun wird, dann wird das Verhältnis der akkumulierten Vermögen im Vergleich zu den laufenden Einkommen immer größer. Simpel formuliert: Wenn alle Einkommen einer Volkswirtschaft 1 Milliarde Euro betragen und die Summe aller akkumulierten Reichtümer (des Kapitals) 4 Milliarden dann ist die „Kapital/Einkommens-Rate“ 400 Prozent. Und sie wächst und wächst, weil dem Kapital immer mehr hinzugefügt wird als den laufenden Einkommen – was logischerweise aus r > g folgt. Woraus aber logischerweise ebenso folgt, dass der Anteil der Kapitaleinkommen am gesamten Einkommen einer Ökonomie stetig steigt.
Als Theorie, mit Formeln und mathematischen Modellen unterlegt, mutet Pikettys Analyse beinahe „deterministisch“ an und erinnert sogar ein wenig an Karl Marx „Verelendungstheorie“, jedenfalls in der Variante der „relativen Verelendung“, die besagt, dass die normalen Lohnabhängigen, mögen auch ein paar Krümel des Wachstums für sie abfallen, relativ zu den Besitzern von Kapital ärmer und ärmer werden. Und tatsächlich ist das auch so. Bloß, Pikettys Theorie ist keine „theoretische Theorie“, sie ist eine „empirische Theorie“, sie formuliert keine ehernen ökonomischen Gesetze, sondern allenfalls beobachtete Gesetzmäßigkeiten. Es gäbe natürlich keinerlei „tiefere Gründe“, warum die Kapitalrendite höher sein müsse als die Wachstumsrate, schreibt Piketty. Dass r > g ist, ist „ein historischer Fakt, keine logische Notwendigkeit“.
Das Grandiose von Pikettys Buch kann eine schnelle Zusammenfassung seiner Grundthesen unmöglich einfangen. Was dieses Buch zu einem großen Buch macht, ist die Fülle der Daten über die Dynamik der Ungleichheit, die nüchterne und zugleich geistreiche Diskussion des Autors über die Ursachen mancher Erscheinungen (etwa die Gründe für die Einkommensexplosion der Top-1-Prozent der Gehaltsbezieher, also der Aufstieg der „Supermanager“ mit ihren Phantasiegehältern und Millionenboni), soziologische und philosophische Erörterungen über Steuern etwa, und Pikettys
Fähigkeit, die historischen Veränderungen durch Verweis auf Literatur oder Populärkultur zu untermauern: Das Buch besteht nicht nur aus Kurven und Daten, sondern auch ausführlichen Beschreibungen von Balzac-Romanen und Hollywood-Filmen.
Fähigkeit, die historischen Veränderungen durch Verweis auf Literatur oder Populärkultur zu untermauern: Das Buch besteht nicht nur aus Kurven und Daten, sondern auch ausführlichen Beschreibungen von Balzac-Romanen und Hollywood-Filmen.
Die Conclusio von Pikettys monumentaler Studie ist klar: Wir haben eine Reichtumskonzentration, wie wir sie seit Beginn des 20. Jahrhunderts nicht mehr hatten, und dieser Prozess verstärkt sich selbst. In den nächsten Jahrzehnten werden mehr und mehr Erben in den Besitz großer Vermögen kommen. Schon jetzt ist das meritokratische Ideal (wer viel verdient oder besitzt, soll das auf irgendeine Weise auch „verdienen“) längst nur mehr ein Phantasie, aber mit der nächsten Erbengeneration wird es endgültig absurd. Noch haben wir auch nicht jene bizarre Konzentration der Reichtümer, noch gibt es zumindest eine schmale Mittelschicht, die ebenfalls Vermögen besitzt (das war ja die große Revolution des 20. Jahrhunderts), aber die Dynamik geht in Richtung einer neuen Oligarchie.
Die Lösung: Eine progressive Steuer auf Kapitalbesitz und konfiskatorische Spitzensätze
Dennoch ist Pikettys Buch keine deprimierende Bestandsaufnahme einer katastrophalen Situation, sondern bei aller akademischen Nüchternheit eine kämpferische Studie. Gewiss, das Panorama, das Piketty ausbreitet, lässt einen nicht besonders optimistisch zurück. Die Nachkriegsjahre, in denen die westlichen Kapitalismen allesamt egalitärer wurden, erscheinen im großen historischen Rückblick als das, was sie sind: Ein kurzer Wimpernschlag der Geschichte. Es zeigt sich auch, dass eine Bremse der Reichtumskonzentration – oder gar deren Verringerung -, kaum durch homöopathische Vermögenssteuern und leichte Progression von Steuersystemen erreicht werden kann (wenngleich auch das schon ein Fortschritt wäre, da die Steuerrealität in den höchsten Einkommensbereichen längst nicht mehr progressiv, sondern degressiv ist – soll heißen: Während die realen Steuer- und Abgabesätze auf mittelhohe Einkommen oft 50 Prozent oder mehr betragen, nehmen sie im Spitzensegment auf rund 30 bis 35 Prozent ab).
Die Entstehung einer Oligarchie, soviel ist für Piketty klar, wird sich nur durch zwei Dinge eindämmen lasse. Erstens: Progressive Einkommenssteuern, die für exorbitante Einkommen de fakto konfiskatorisch sein müssen – also jene 80 bis 90 Prozent Steuersatz für Jahreseinkommen über, beispielsweise, 5 Millionen Euro, die wir in den USA und Großbritannien in den Nachkriegsjahren hatten.
Zweitens: Eine progressive, globale Besteuerung von Vermögen, sei dies etwa durch Erbschaftssteuern im Bereich von 30 bis 50 Prozent oder – für Mega-Vermögen – noch höher, beziehungsweise durch jährliche progressive Substanzsteuern auf Vermögen. Piketty: „Man könnte sich einen Steuersatz von 0 Prozent für Vermögen unterhalb von 1 Million Euro vorstellen, 1 Prozent für Vermögen zwischen 1 und 5 Millionen, und 2 Prozent für Vermögen über 5 Millionen. … Wenn man ein ambitionierteres Ziel verfolgen will, nämlich das, die Vermögensungleichheit auf moderateres Niveau zu reduzieren, könnte man Steuersätze von 10 Prozent oder mehr für Milliardäre einführen.“
All das müsste natürlich am besten auf globaler Ebene, in jedem Fall innerhalb des Rahmens der Europäischen Union beschlossen werden.
Piketty selbst weiß und sagt natürlich, dass das auf dem ersten Blick „utopisch“, ja, völlig unmöglich erscheint. Aber, so fügt er hinzu, „die europäischen Staaten waren in der Lage eine gemeinsame Währung einzuführen“, wieso also soll dann eigentlich eine Steuerharmonisierung, die endlich wieder die Möglichkeit schafft, große Vermögen zu besteuern, so unmöglich sein? Ist das eine wirklich utopischer als das andere?
Dieses Buch ist ein Game-Changer, wie die Amerikaner sagen, es ändert die Debattenlage, eine Diskurs-Wasserscheide. Wer künftig weiter für „Steuerkonkurrenz“ von Staaten eintritt, sich gegen Steuerharmonisierung sperrt, die Forderung von Erbschafts- und Vermögenssteuern als „Neiddebatte“ verächtlich macht, der muss sich fragen lassen, was er sonst gegen die Deformation unserer Gesellschaften in neofeudalistische Oligarchien machen will – oder ob er tatsächlich eine solche neue oligarchische Ordnung als irgendwie erstrebenswert ansieht. Das Bestechende an dem Buch ist das Zwingende seiner Argumentation. Die Daten und empirischen Fakten, die Piketty ausbreitet, lassen buchstäblich keinen Zweifel daran, dass er recht hat.
Neoliberale und Konservative werden uns sicher weiter einreden wollen, dass im Kapitalismus alle reich werden können und der, der Reichtum und hohe Einkommen besitzt, diese schon irgendwie verdient haben wird. „Wenn dafür überhaupt ein Beweis nötig ist, schreibt Piketty, „dann zeigt die Erfahrung, dann keine Heuchelei groß genug sein kann, wenn die wirtschaftlichen und finanziellen Eliten ihre Interessen verteidigen.“