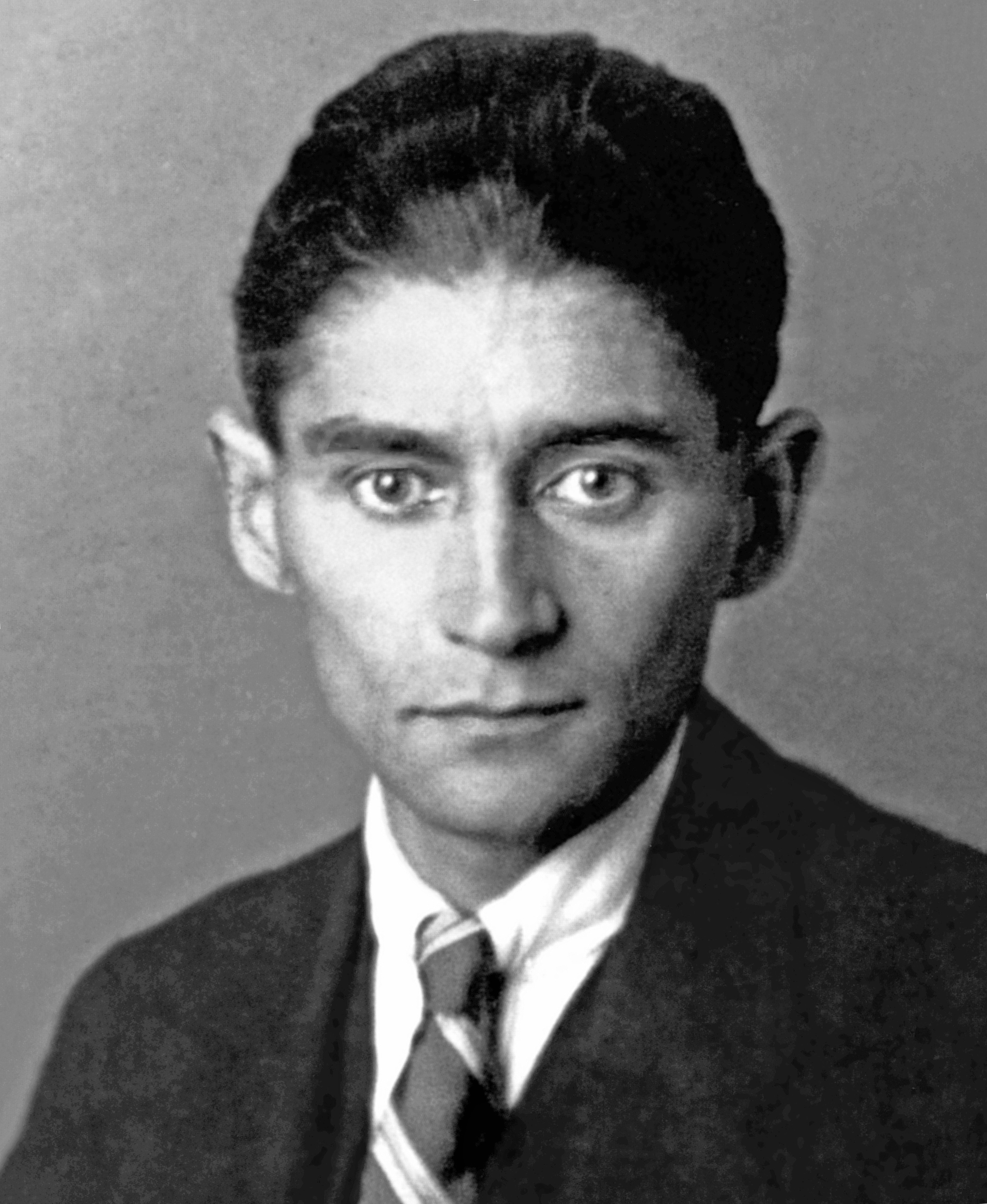Freitag, 26. Jänner, 18 Uhr, Parlament. Denn: Genug ist genug. Es reicht!
Am kommenden Freitag, 26. Jänner, wird jetzt auch in Wien gegen den Aufstieg des Rechtsextremismus, die haarsträubende Radikalisierung und, schlicht und einfach, gegen die FPÖ demonstriert.
Freitag, 18 Uhr, vor dem Parlament.
Es ist eine bunte Mischung an Leuten, die sich jetzt kurzfristig zusammengetan haben. Das Bündnis für eine menschliche Asylpolitik mit unserem wunderbaren Freund und Mitstreiter Erich Fenninger, die Fridays for Future, die „Blackvoices“ – die von der „Black Lifes Matter“-Bewegung inspiriert sind, und viele andere die dann dazu stießen.
Es wird auch ein großartige Line-Up geben, mit Rednerinnen und Rednern, Beiträgen von Autorinnen, den wichtigsten Künstlern des Landes (Spoiler: Solltest Du Dir allein deshalb nicht entgehen lassen). Es ist mal der erste große Pflichttermin im Jahr, wie man das so nennt. Weitere werden folgen müssen, wenn wir unser Land nicht aufgeben wollen.
Der emotionale Anstoß ist natürlich der unerwartete Aufstand von Millionen in Deutschland – alleine am vergangenen Wochenende haben rund 1,5 Millionen Menschen in dutzenden oder hunderten Städten demonstriert.
Salopp wird da gesagt, da ist das echte Volk auf der Straße, die breite „Mitte der Gesellschaft“. Und das stimmt ja auch. Aber Mitte ist ein nicht ganz präziser Begriff, denn bei „Mitte“ kommt gleich die Vorstellung hoch von einer politischen Geografie auf, hier links, dort rechts, dazwischen die „Mitte“. Es ist eher die Mitte der heutigen, bunten Normalität in heterogenen Gesellschaften. In diesem Sinne ist es eine Mitte. Und auch nicht eine Phantasievorstellung vom „Volk“, bei dem dann gleich Bilder von Homogenität aufpoppen, sondern die breite „Bevölkerung“, die unterschiedlich ist, aber doch durch eines geeint. Nämlich durch das Gefühl: Es reicht. Genug ist genug.
Gustav Seibt schrieb in der „Süddeutschen Zeitung“ nach diesen Manifestationen:
„Am Wochenende sah man einen Querschnitt der bundesrepublikanischen Gesellschaft mit all ihren Unterschieden: alt und jung, bürgerlich und alternativ, elegant, casual, reich, arm, migrantisch, städtisch, ländlich, junge Familien, Omas, schwul-lesbische Pärchen, östlich-westlich (Gott sei Dank!), politisch streng, politisch ironisch, programmatisch so divers wie im Habitus, sofern sich die Zeichen überhaupt entziffern lassen. Insgesamt: vollkommen inhomogen. Äußerlich: nicht formiert, locker gestreut im Raum, flanierend, trottend, kommend und gehend. Vollkommen zivil, überwiegend entspannt.“
Wie wirkungsvoll solche Mobilisierungen sind, lässt sich empirisch meist schwer messen, aber ein paar Untersuchungen gibt es. Etwa aus Italien, wo Forscher und Forscherinnen anti-rechte Bewegungen in mehreren Regionen untersucht haben und anhand der Regionalwahlen 2020 die Effekte analysierten. Fazit: In Städten und Gemeinden, in denen es große Mobilisierungen gegeben hat, gab es eine „Reduktion der Stimmen für die radikale Rechte“ von bis zu vier Prozent – verglichen mit Städten, in denen es solche Proteste nicht gab. Ähnliche Evidenz brachten Studien über die französische Präsidentschaftswahl 2002 zutage und Forschungen aus Griechenland. Es sind eine Reihe von Faktoren, die dabei zusammenwirken, so die verschiedenen Untersuchungen. Einerseits gibt es eine „Signalwirkung“, dass rechtsextreme Stimmabgabe sozial in der Gemeinde stigmatisiert ist (was schwankende Mitläufer der Rechten beeindruckt), andererseits etablieren die Proteste „Informationsnetzwerke“, außerdem heben sie die Wahlbeteiligung bei den Gegnern der Rechtsradikalen. Und langfristig werden neue Generationen an Aktivisten „politisiert“, was später langjährige Effekte hat. Mobilisierung wirkt also – wenngleich es sicherlich nicht mit ein, zwei Protestwochenenden getan ist.
Eine der wichtigsten Wirkungen solcher Mobilisierungen: Sie bekämpfen den größten Feind der Demokraten, nämlich die Lethargie, die Larmoyanz und die Resignation.