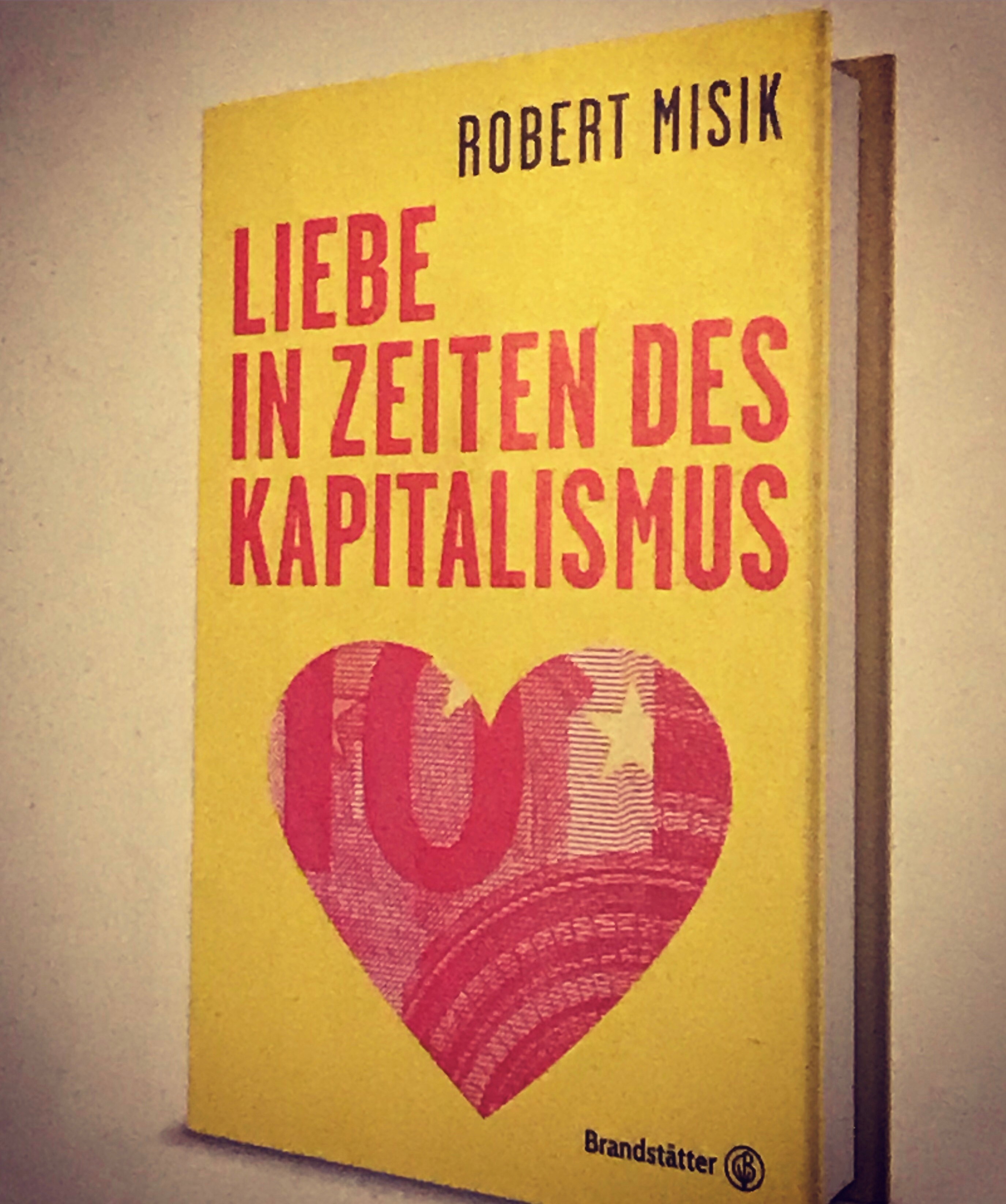Meine taz-Kolumne zum 200. Geburtstag von Karl Marx
Die 50-Jahre-Achtundsechziger-Gedenktage haben ihren ersten Höhepunkt hinter sich, und schon rollen die 200-Jahre-Karl-Marx-Festivitäten auf uns zu. In seiner Geburtsstadt Trier stellten sie am Geburtstag die Marx-Statue auf, die der Stadt von den Chinesen geschenkt wurde. Dieses Standbild im Stile des pathetischen Pseudorealismus ist geradezu eine Verkörperung der Paradoxien unserer Zeit. Die Trierer Lokalpolitik steckte in dem Dilemma, dass ihr die Annahme des Präsentes ebenso peinlich gewesen ist wie dessen potentielle Ablehnung, zumal eine Absage an die chinesischen Parteikommunisten ein Affront gewesen wäre und Tourismus und Handelsbeziehungen mit der aufstrebenden wirtschaftlichen Weltmacht China belasten hätte können. Schöne Pointe: Man muss dem guten alten Karlchen ein Denkmal setzen, um keine kapitalistischen Absatzmärkte zu gefährden. Big Old Rauschebart hätte seine helle Freude an einer solchen Verrücktheit.
Der wusste ja schon in seinen legendären „Grundrissen“, dass im entwickelten kapitalistischen Weltmarkt „die Verrücktheit (für) das praktische Leben der Völker bestimmend“ würde.
Während der Rückblick auf die 68er bestenfalls von jener nostalgischen Zärtlichkeit ist, mit der man sich an die eigene Pubertät erinnert – mitsamt ihren sympathischen Verirrungen -, und kaum jemand fragt, ob das Exempel von 1968 irgendetwas für unsere Gegenwart zu bedeuten hat, so ist das Marx-Gedenken von einer ganz anderen Art: Stets schwingt die Frage mit, und sei es nur als Verdacht, dass uns der Alte für heute noch gehörig etwas zu sagen habe. Dass einer wie er fehlt. Das ist allein ja schon bemerkenswert bei einem, der mehr als 130 Jahre tot ist.
Einer der Giganten der Geistesgeschichte ist er sowieso. In Philosophie, Soziologie, Politikwissenschaften, in Ökonomie – also im gesamten modernen Denken -, hat er dem Wissen einen neuen Kontinent eröffnet.
Marx lesen ist immer noch der beste Beginn, um denken zu lernen. Seine ungebrochene Größe besteht in seiner Methodik, soziale Prozesse zu verstehen. Dass viele Akteure Handlungen setzen, manche bewusst geplante, andere eher instinktive; vom politischen Agieren bis zur Profitmaximierung, von neuesten technologischen Erfindungen bis zum Kampf um höhere Löhne oder bessere Arbeitszeiten. Diese unzähligen Impulse summieren sich zu einem neuen Arrangement, das aber von niemanden geplant war, das kapitalistische Verhältnis ist ein „Verhältnis von Verhältnissen“, oder, wie Marx-Buddy Engels einmal schrieb, „eine Wechselwirkung“ und eine „unendliche Menge von Zufälligkeiten“, die zwar alle ein Resultat von Einzelwillen seien, wobei aber etwas heraus kommt, „das keiner gewollt hat“.
Was aber logisch heißt: Mit Überraschungen ist stets zu rechnen und so etwas wie eine stabile Lage existiert nicht. Auch in stabilen Lagen tun unzählige Akteure irgend etwas, was die Stabilität untergräbt. „Weil es so ist, bleibt es nicht so“, sagte Brecht einmal, was ja etwas ganz anderes heißt als beispielsweise „weil es schlecht ist, bleibt es nicht so“. Sondern: Weil jeder Status quo ein Kraftfeld ist, wird es nicht so bleiben, und jedes Agieren wird paradoxe Folgen haben.
Witziger Kerl war dieser Marx auch, und wir haben stets ein falsches Bild von ihm, weil die einzigen Fotos einen Ehrfurcht erweckenden alten Rauschebart zeigen. Aber der Typ war ja primär jung. 24, als er für die Rheinische Zeitung zu schreiben begann, 26, als er die berühmten „Pariser Manuskripte“ schrieb, keine dreißig, als er das Kommunistische Manifest hinkritzelte. Betrunken schlug er schon mal spaßeshalber mit Steinen die Gaslaternen ein.
Einer der schönsten Marx-Texte ist jener über „produktive Arbeit“, der das Prozessdenken des Autors auf die ironische Spitze treibt: „Ein Philosoph produziert Ideen, ein Poet Gedichte, ein Pastor Predigten, ein Professor Kompendien usw. Ein Verbrecher produziert Verbrechen.“ Aber der Verbrecher produziert nicht nur Verbrechen, er produziert auch das Kriminalrecht, er produziert auch den Professor, der Vorlesungen über Kriminalrecht hält, und damit die Kompendien, die der Professor schreibt. „Der Verbrecher produziert ferner die ganze Polizei und Kriminaljustiz, Schergen, Richter, Henker, Geschworene…“ Der Verbrecher produziert auch moralische Gefühle, und sei es bloß aus Ablehnung, und natürlich schöne Literatur, wären doch Schillers „Räuber“ ohne ihn nicht denkbar. Der Verbrecher trägt seinen Teil zur Steigerung der Produktivkräfte bei: „Wären Schlösser je zu ihrer jetzigen Vollkommenheit gediehn, wenn es keine Diebe gäbe?“
Wer ein wenig marxistoid ist, der wird so gesehen stets einen Grundoptimismus bewahren: Es gibt nichts, was nicht auch seine positiven Seiten hätte. Oder zumindest fast nichts.